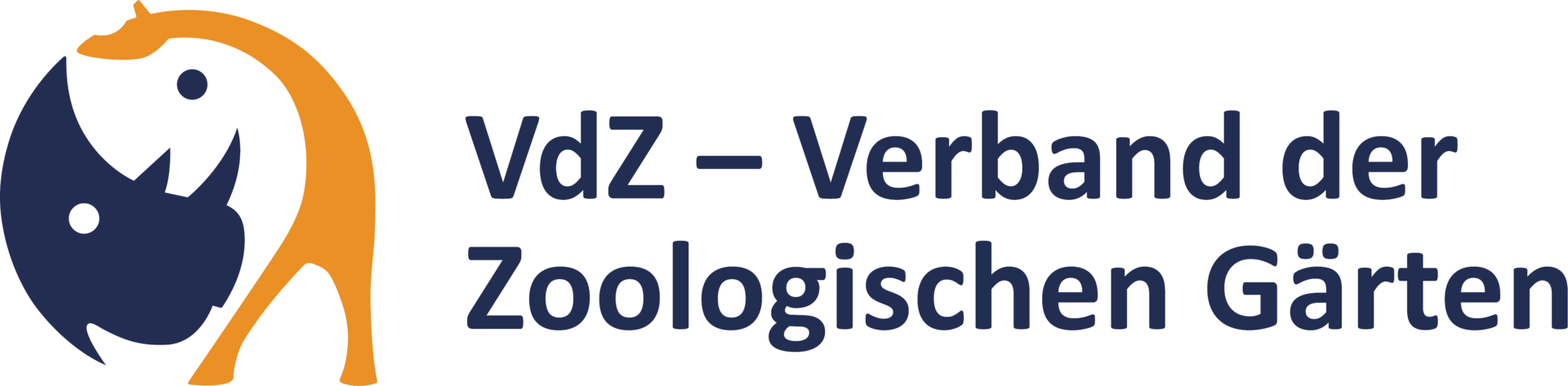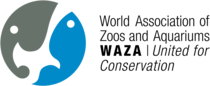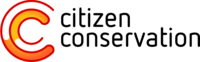Tierversuche – auch in Zoos
Das Ziel der Forschung in Zoos ist es, das Wohlbefinden der Tiere zu verbessern, Arten zu schützen und die wissenschaftliche Grundlage für eine noch bessere Haltung zu schaffen – sowohl in Zoos als auch im ursprünglichen Lebensraum. Viele Erkenntnisse aus Tierversuchen in Zoos helfen dabei, bedrohte Arten besser zu verstehen und ihre Überlebenschancen in der Natur zu erhöhen.

Für Großkatzen werden beispielsweise Duftspuren im Gehege gelegt oder Obst und Fische werden für Bären in einer Eisbombe versteckt. Affen müssen aus Stocherkisten oder Bambusrohren ihr Futter „angeln“. So wie das Tier in der Wildnis muss sich dann auch das Zootier anstrengen, um an sein Futter zu gelangen. Es wird animiert, sein artgemäßes Verhalten auszuleben.
Als Tierversuche gelten Eingriffe oder Behandlungen zu Versuchszwecken an Tieren, wenn sie mit Schmerzen, Leiden oder Schäden für diese Tiere verbunden sein können. In geringem Umfang finden genehmigungspflichtige Tierversuche auch in Zoos statt – allerdings mit kaum spürbarem Stress für unsere Tiere.
Zoos planen Forschungsvorhaben, um Tiere besser zu verstehen. Dafür können Tiere aus wissenschaftlichen Zwecken in ein anderes Gehege gebracht oder die Einrichtung ihres Geheges leicht verändert werden. Oder es werden biologische Proben (z. B. Haare oder Blut) gesammelt, um genetische Untersuchungen durchzuführen. Diese Vorhaben können als Tierversuch bewertet werden, da für die Tiere minimaler Stress entstehen könnte. Es handelt sich also um Tierversuche mit äußerst geringem Belastungsgrad. Die Forschungsvorhaben haben die Grundlagenforschung zur Biologie der Tiere zum Ziel, aber auch zur Verbesserung von Haltungsbedingungen und zum genrellen Wohlbefinden der Tiere. Ebenso werden wichtige veterinärmedizinische und genetische Fragstellungen bearbeitet.
Tierversuche verstehen
Vier VdZ-Zoos sind Unterzeichner der „Initiative Transparente Tierversuche“. So unterstützen der Grüne Zoo Wuppertal, der Tiergarten Nürnberg, der Allwetterzoo Münster und die Stuttgarter Wilhelma als sehr aktive Forschungsstandorte diese Initiative der Informationskampagne „Tierversuche verstehen“ und der Ständigen Senatskommission für tierexperimentelle Forschung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG).
Die Initiative Transparente Tierversuche zielt darauf ab, die sachbasierte und offene Diskussion zur Forschung mit Tieren weiter voranzutreiben.
Grundsätzlich unterstützt der VdZ das 3R Prinzip in der Tierversuchsforschung. So sollen Versuche nach Möglichkeit durch Alternativen ersetzt (Replace), die Zahl der eingesetzten Tiere auf ein Minimum verringert (Reduction) und die Belastung der Tiere natürlich so gering wie möglich gehalten werden (Refinement).
Rechtlicher Hintergrund
Die Richtlinie 2010/63 des EU Parlaments und des EU Rates zum Schutz der für wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere gilt als juristisches Basisregelung für Tierversuche in den europäischen Mitgliedsstaaten. Weitere Regelungen unterliegen nationaler Gesetzgebung. In Deutschland sind Tierversuche, Genehmigungsprozesse und Methoden etwa im deutschen Tierschutzgesetz und nachfolgend in der deutschen Tierschutz-Versuchstierverordnung geregelt. Das deutsche Tierschutzgesetz definiert Tierversuche als „Eingriffe oder Behandlungen zu Versuchszwecken an Tieren, wenn sie mit Schmerzen, Leiden oder Schäden für diese Tiere verbunden sein können“. Die Genehmigungsprozesse und Anforderungen unterscheiden sich allerdings je nach Bundesland und Einschätzung der genehmigenden Behörden teilweise stark.